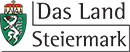Wie kann man Wissenschaft vermitteln?
Experten diskutierten die Lage von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Der steirische Forschungsrat fordert den Erhalt des Wissenschaftsministeriums.
Die steirische Wissenschafts-Landesrätin Kristina Edlinger-Ploder betonte mit Stolz, dass in der Steiermark die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bereits jetzt weit über dem Österreich-Schnitt lägen und die Budgettöpfe für Wissenschaft und Forschung auch vom Konsolidierungskurs der Reformpartnerschaft in der Steiermark nicht gekürzt werden. "In den letzten zwanzig Jahren hat sich auf dem Gebiet des Wissenschaftsjournalismus viel getan. Zu meiner Zeit gab's dafür nur Ö1, heute gibt es unterschiedliche TV-Formate, Beilagen in Zeitungen und Magazinen. Es kann aber noch mehr sein." Edlinger-Ploder wünscht sich von Wissenschaftsjournalisten mitunter auch Rückenwind für Investitionen, wie etwa in die Grundlagenforschung, deren Notwendigkeit von vielen Teilen der Öffentlichkeit nicht gleich auf den ersten Blick erkannt wird.
Dass Artikel über Wissenschafts-Themen konsumiert werden, ortet Oliver Lehmann, Sprecher des Institute of Science and Technology Austria im niederösterreichischen Gugging: "Es haben mehr Artikel einen Bezug zur Wissenschaft als auf den ersten Blick erkennbar. Ich denke hier nur an Berichte über Umweltkatastrophen, wo die Meteorologie wichtige Fakten liefert. Die Wissenschaft kommt eben nicht immer mit dem richtigen Mascherl daher."
Wissenschaft in der Zwickmühle
Wie stark sich das Bild des Wissenschaftsjournalismus in den letzten Jahrzehnten geändert hat, legte die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin Corinna Lüthje dar: "Durch die Kürzung von Budgetmitteln oder Finanzierung durch Konzerne wird die Wissenschaft leichter korrumpierbar. Der finanzielle Druck sorgt mitunter dafür, dass durch das gezielte Forcieren von Themen - in der Hoffnung, damit eine Schlagzeile zu landen - verstärkt Fehlinformationen publiziert werden. Es haben sich Firmen gebildet, die im Auftrag von Unternehmen Wissenschafts-PR betreiben. Die Aufgabe des Wissenschafts-Journalismus ist daher auch, wissenschaftliche Ergebnisse zu evaluieren." Wissenschaftsjournalist Martin Kugler und Günther Mayr, Leiter der Aktuellen Wissenschaft im ORF Fernsehen, sehen diese Aufgabe allerdings nicht bei den Journalisten. "Wie gut eine Wissenschaft ist, können wir nicht beurteilen. Das muss die Wissenschaft tun", betont Kugler und erhält Rückendeckung von Günther Mayr: "Pro Tag kommen 200 Mails herein. Das Evaluieren von Ergebnissen ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich."
Grundlagenforschung im medialen Abseits
Erhalt des Wissenschaftsministeriums unabdingbar
Diskussionsleiter und Kommunikationswissenschaftler Matthias Karmasin formulierte abschließend zwei Wünsche für die Zukunft: „Es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es dem Wissenschaftsjournalismus ermöglichen, an die Menschen heranzutreten - und zwar ohne Abhängigkeiten. Und der zweite Wunsch: Der Wissenschaft muss es gelingen, den Menschen klar zu machen, dass Ausgaben für Forschung und Entwicklung gut angelegtes Geld ist, auch wenn - wie in der Grundlagenforschung - am Ende vielleicht nicht viel herauskommt oder etwas anderes, als eigentlich erwartet wurde."
Als erste Konsequenz aus der Diskussion hat der steirische Forschungsrat einstimmig beschlossen, der Landesregierung zu empfehlen, sich vehement für den Erhalt des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung einzusetzen.